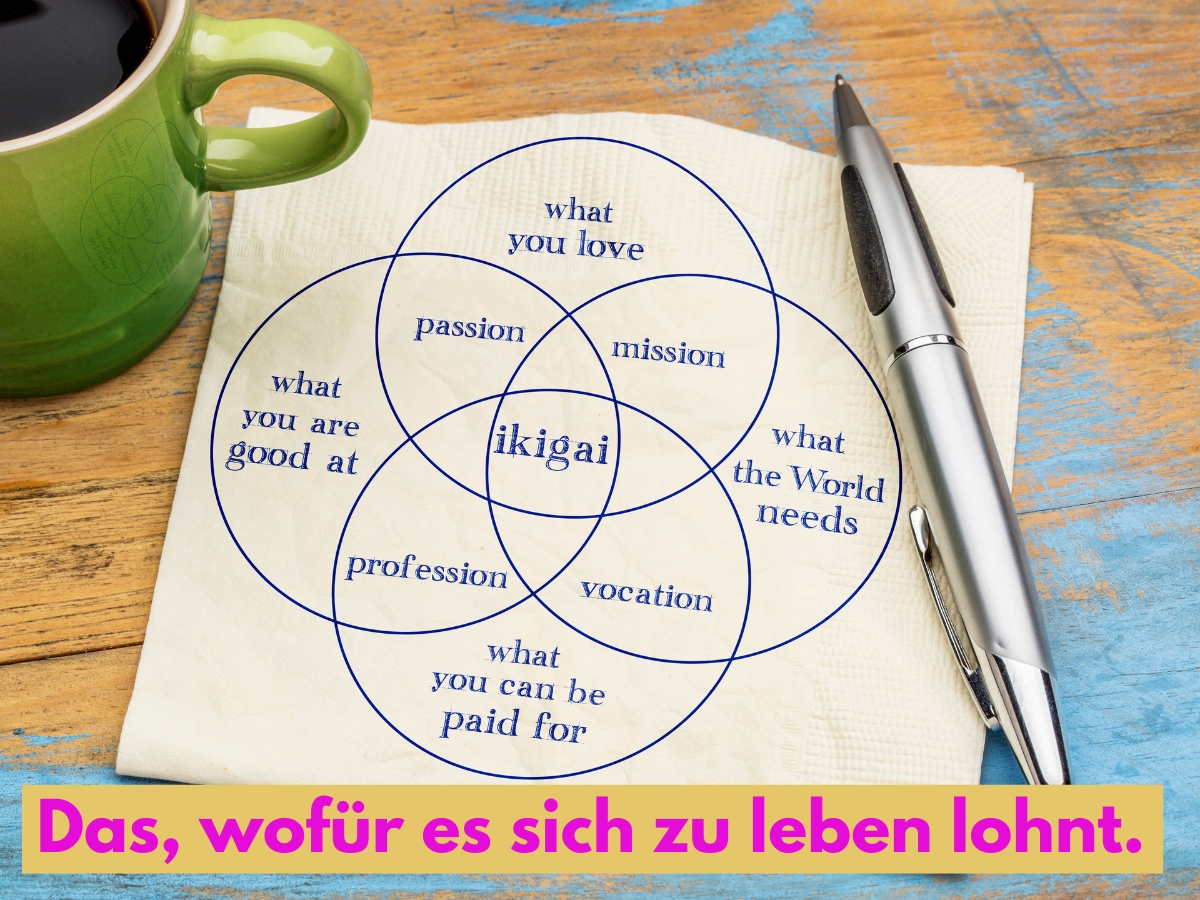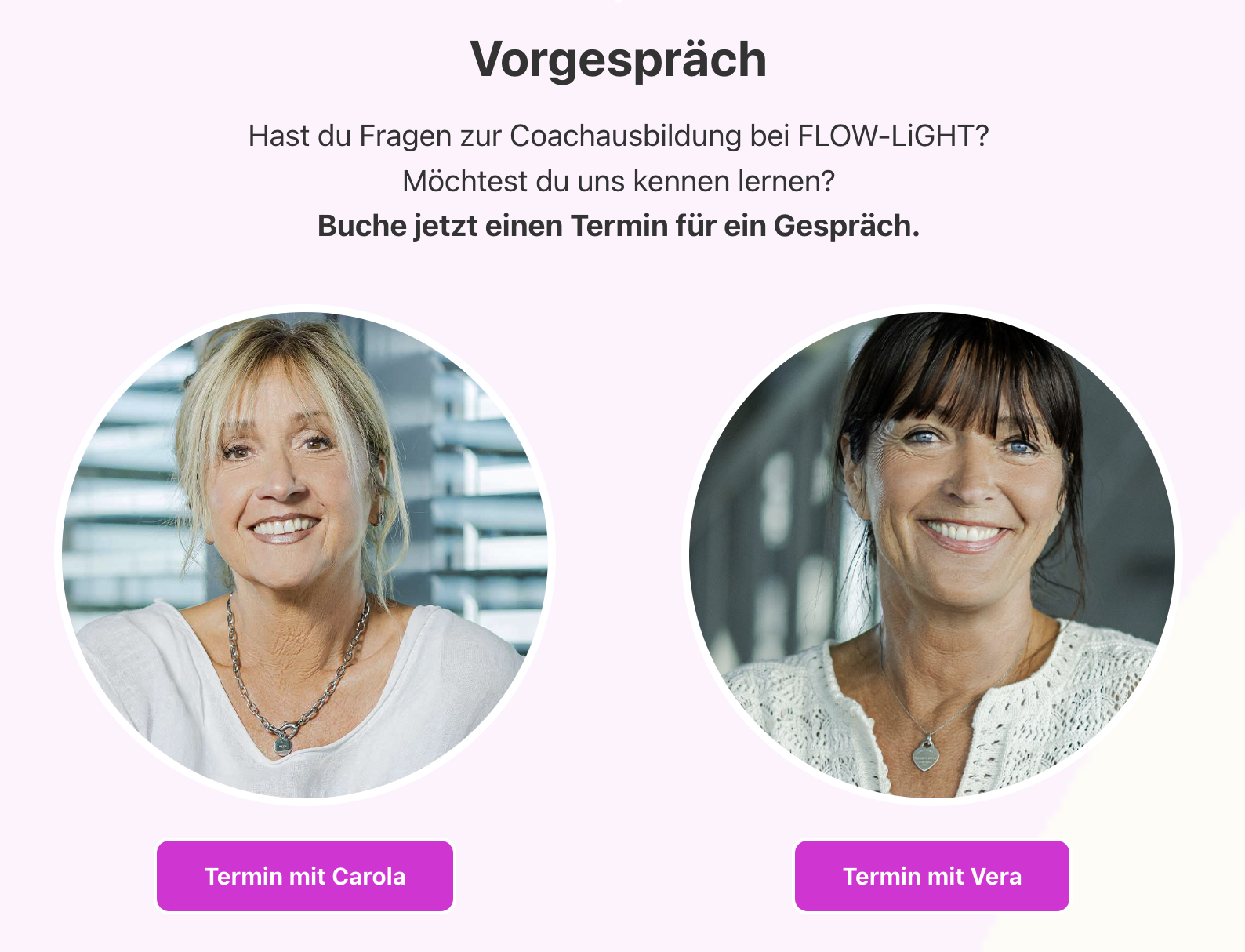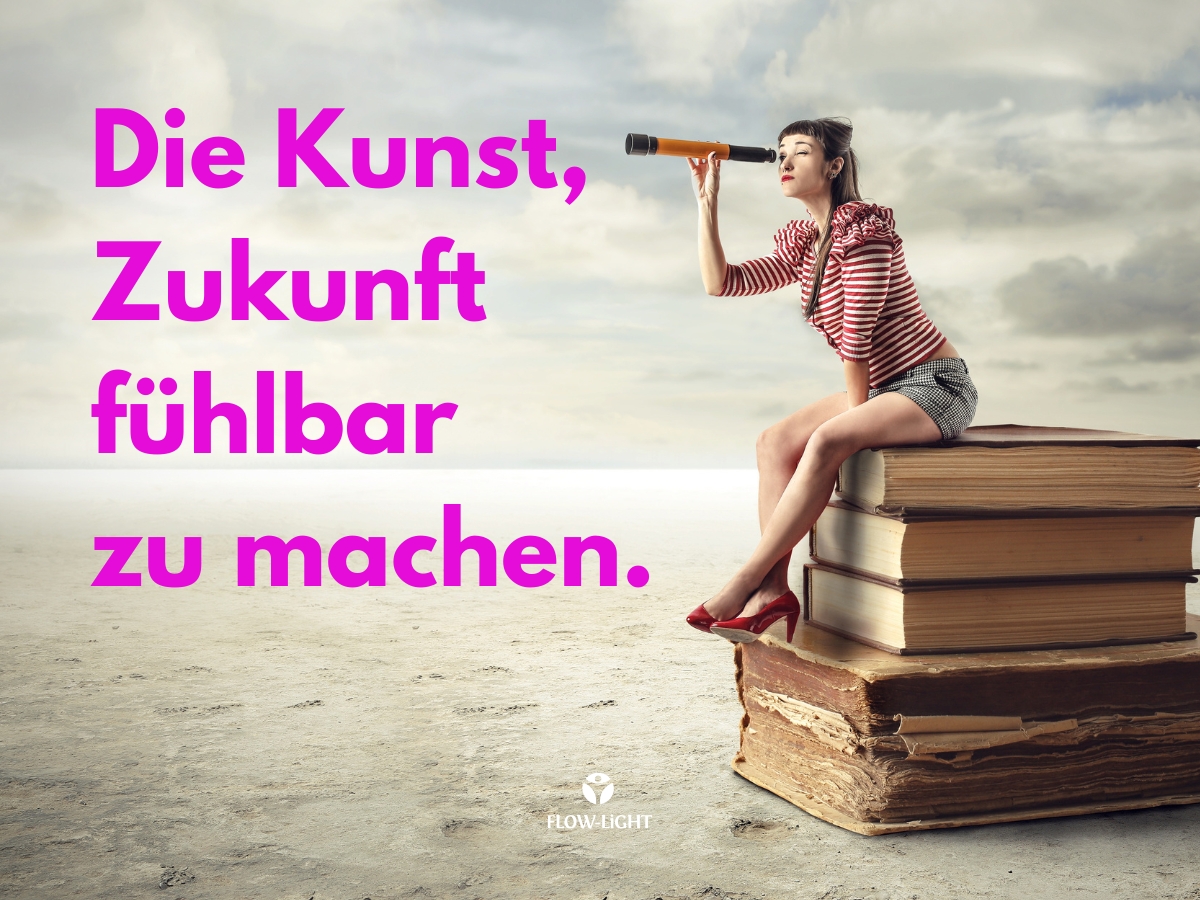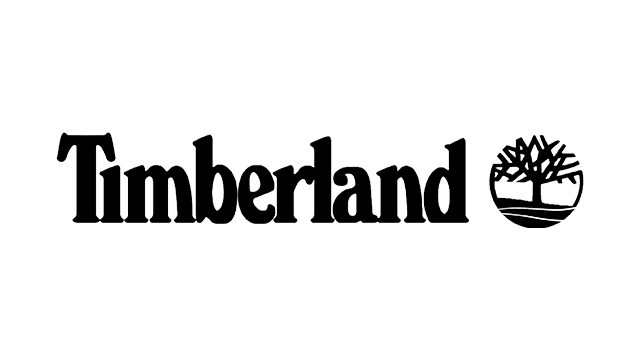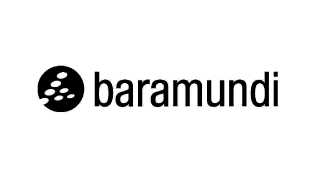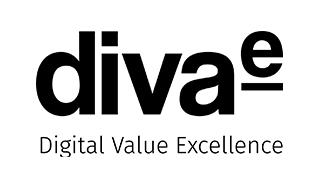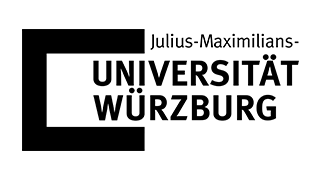Politische Macht-Spielchen. Wer kenn sie nicht?
In jeder Organisation gibt es unsichtbare Kräfte, die mitentscheiden: Interessen, Allianzen, unausgesprochene Spielregeln, historische Prägungen. Und auch wenn niemand offiziell davon spricht, wir alle nehmen sie wahr. Dieses Feld bezeichnen wir als „Politik“. Und wer hier mitspielen will, braucht eine besondere Kompetenz: politische Sensibilität.
Was bedeutet das genau? Es geht um mehr als taktisches Verhalten oder strategisches Denken. Politisch sensible Menschen können fein wahrnehmen, welche Dynamiken wirken, wann Einfluss genommen wird und warum manche Dinge gesagt – oder gerade nicht gesagt – werden. Sie erkennen die emotionalen Schichten eines Meetings, die Energieverteilung in einem Projekt oder die unausgesprochenen Loyalitäten innerhalb eines Teams.
Ein Beispiel: In einem Projektmeeting herrscht auffällige Harmonie. Alle nicken, keiner widerspricht, obwohl der Plan offensichtlich Schwächen hat. Politisch sensible Menschen spüren: Hier stimmt etwas nicht. Das Schweigen ist kein Konsens, sondern Schutzstrategie. Vielleicht vor Gesichtsverlust. Vielleicht aus Angst vor Sanktionen. Die entscheidende Frage lautet dann nicht: „Warum sagt niemand etwas?“, sondern: „Was passiert hier eigentlich?“
Diese Art von Wahrnehmung ist kein misstrauischer Blick durch die Hintertür, sondern ein Akt bewusster Aufmerksamkeit. Politische Sensibilität erlaubt es, integrer zu handeln. Weil wir erkennen, was unter der Oberfläche mitspielt. Und weil wir uns dann entscheiden können: Will ich das ansprechen? Wie formuliere ich Kritik, ohne bloßzustellen? Wo braucht es Rückhalt, um unbequeme Wahrheiten zu benennen?
Gerade im Coaching erleben wir oft, dass politische Dynamiken zu Unsicherheit führen. Menschen spüren, dass etwas nicht stimmt, können es aber nicht benennen. Oder sie fragen sich, ob sie mitspielen müssen, um nicht ins Abseits zu geraten. Hier wird politische Sensibilität zum Machtfaktor, nicht im Sinne von Manipulation, sondern als Fähigkeit, wirksam und gleichzeitig integer zu handeln.
Wir lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Machtspiele zu erkennen, ohne sie zu befeuern. Dialogräume zu öffnen, in denen wieder Wahrheit gesagt werden kann. Und genau darin liegt die eigentliche Stärke: nicht in Lautstärke oder Position, sondern in kluger, feinjustierter Präsenz.